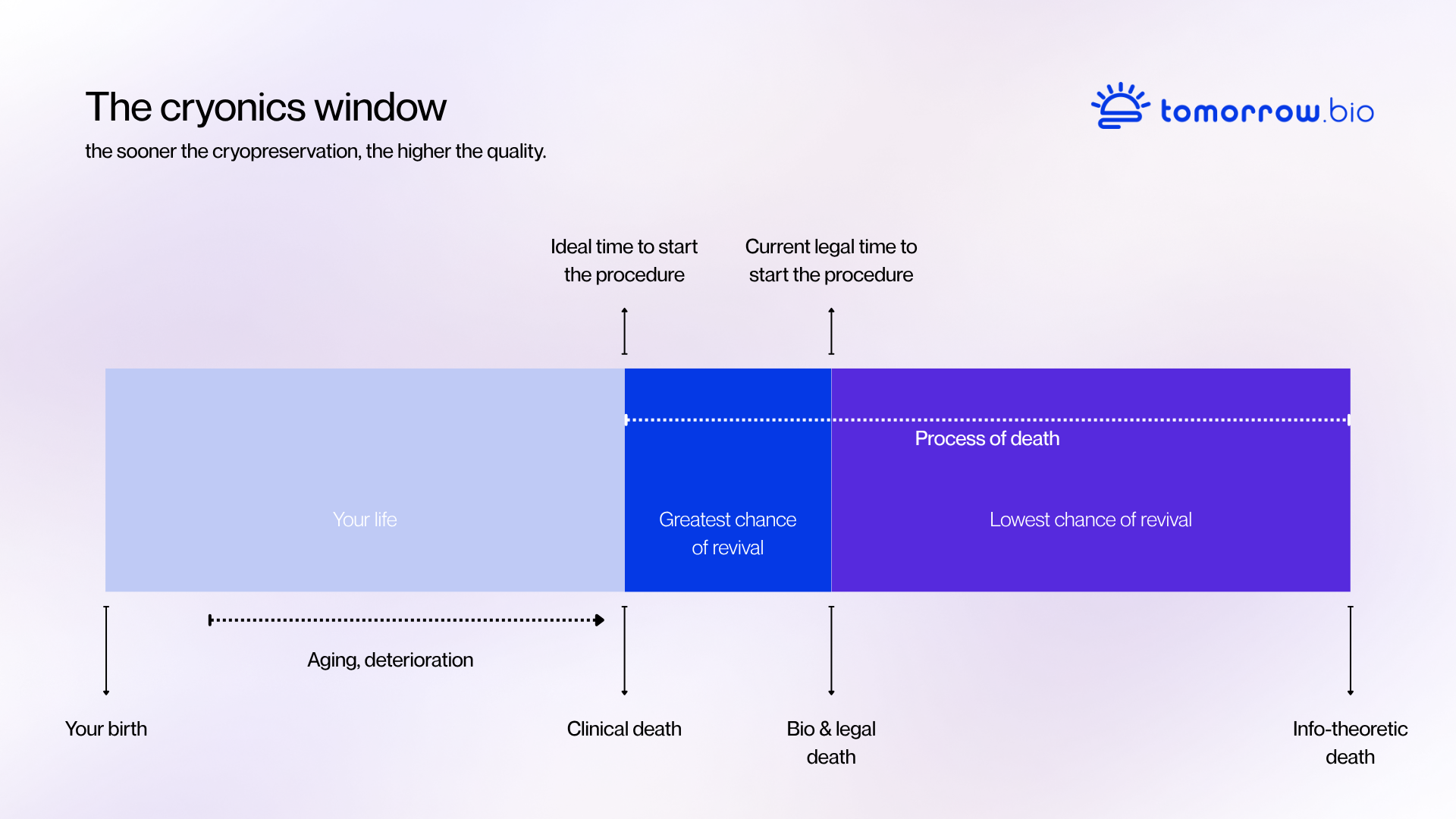Ziel der Kryokonservierung ist es, die biologische Zeit anzuhalten. Dazu muss eine Temperatur erreicht werden, bei der die molekulare Bewegung und damit alle chemischen und biologischen Prozesse, die den Zerfall vorantreiben, effektiv zum Stillstand kommen. Dieser Punkt liegt weit unter der Gefriertemperatur von Wasser und sogar unter dem Bereich, der für die meisten biologischen Lagerungen verwendet wird. Die Temperatur von -196 Grad Celsius, dem Siedepunkt von flüssigem Stickstoff, ist zum Standard geworden, weil sie sowohl physikalische Stabilität als auch biologische Konservierung in einem Umfang bietet, den keine andere Umgebung leisten kann.
Bei normalen Gefriertemperaturen schädigt die Bildung von Eiskristallen Zellen und Gewebe. Das Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus, wodurch die Membranen reißen und die Molekularstrukturen verzerrt werden. Bei der Kryokonservierung wird dies durch Verglasung vermieden. Dabei wird das Zellwasser durch Kälteschutzmittel ersetzt und so schnell abgekühlt, dass es sich in einem glasähnlichen Zustand verfestigt, anstatt in kristallinem Eis. Unterhalb von etwa -130 Grad Celsius, der Glasübergangstemperatur, verfestigt sich dieser glasartige Zustand. An diesem Punkt verlangsamen sich die molekularen Bewegungen und chemischen Reaktionen so stark, dass biologisches Material praktisch zeitlos wird.
Es ist wichtig, die Stabilität unterhalb dieser Schwelle zu erhalten. Wenn die Temperaturen zu nahe am Glasübergangspunkt ansteigen, könnte sich die glasartige Struktur teilweise entspannen oder rekristallisieren, was zu Schäden führen würde. Durch die Lagerung des konservierten Materials bei -196 Grad Celsius bleibt das System weit unter diesem Grenzwert, was eine große Sicherheitsspanne bietet und sicherstellt, dass das verglaste Gewebe auf unbegrenzte Zeit strukturell stabil bleibt.
Um diese Umgebung zu erreichen und aufrechtzuerhalten, wird flüssiger Stickstoff verwendet, da er sowohl natürlich vorkommt als auch bemerkenswert effizient ist. Wenn er kocht, hält er eine konstante Temperatur von -196 Grad Celsius aufrecht und bildet einen selbstregulierenden Wärmepuffer. So kann die kryogene Lagerung ohne aktive Kühlung oder Strom stabil bleiben. Patienten und biologische Proben werden in vakuumisolierten Dewars aufbewahrt, die die Wärmeübertragung minimieren und bei denen nur regelmäßig Stickstoff nachgefüllt werden muss, der durch langsame Verdunstung verloren geht.
Bei dieser Temperatur kommt der biologische Abbau vollständig zum Stillstand. Enzymatische Aktivität, mikrobielles Wachstum und spontane molekulare Reaktionen hören auf. Die Bindungen, die die Architektur von Körper und Gehirn ausmachen, bleiben intakt und bewahren die in ihren Strukturen kodierten Informationen. Die Wahl von -196 Grad Celsius ist daher nicht willkürlich, sondern spiegelt den Punkt wider, an dem Physik, Chemie und Biologie zusammenkommen - wo die Materie stabil bleibt, die Informationen intakt bleiben und die Zeit selbst für den konservierten Patienten stehen bleibt.